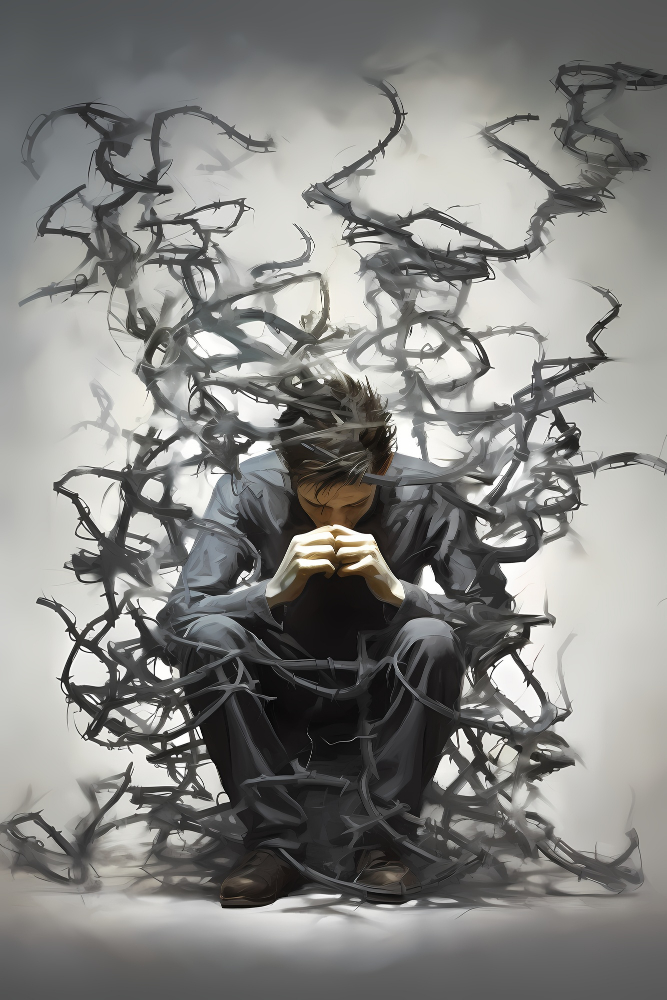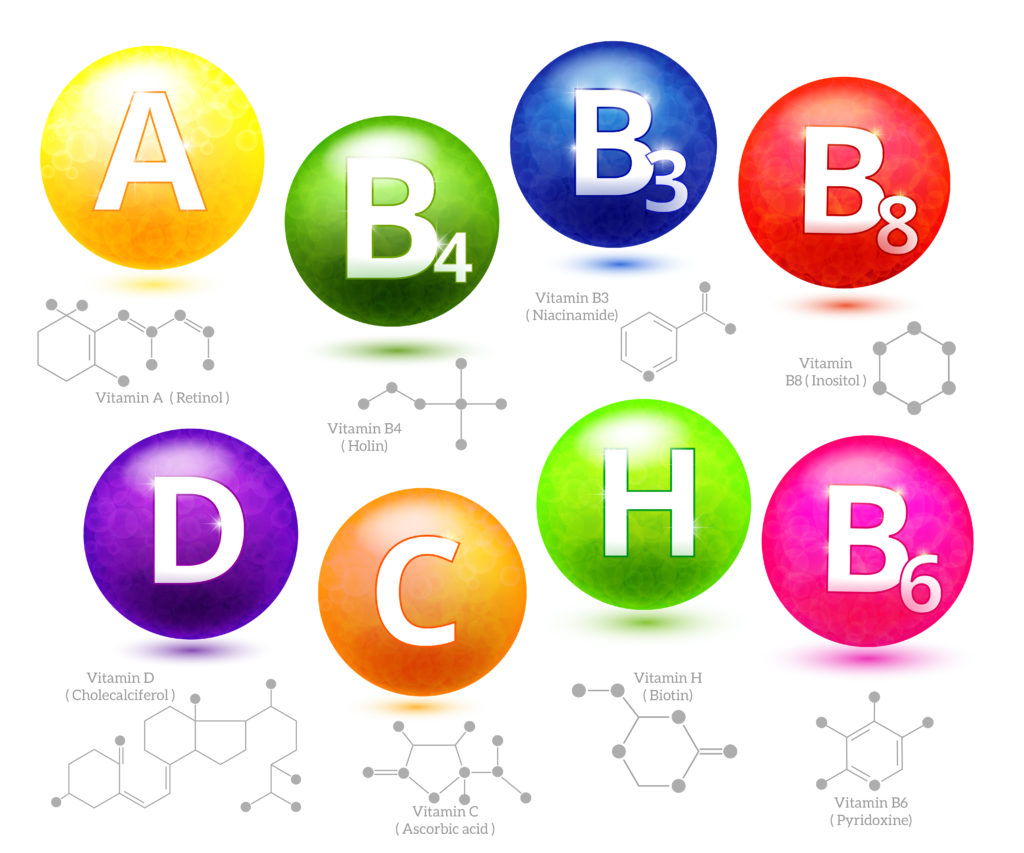Long-Covid ist eine körperliche Erkrankung – wichtige medizinische Fakten
Long-Covid ist keine psychosomatische, sondern eine körperliche Erkrankung mit teils schweren Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Allerdings betreffen die langfristigen Folgen nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche und das soziale Leben. Die genaue Ursache von Long-Covid ist noch nicht vollständig geklärt aber zunehmend erforscht. Verschiedenen Mechanismen wirken zusammen und verstärken sich gegenseitig, wodurch die verschiedenen Symptome entstehen. Die Symptome und der Schweregrad können von Person zu Person unterschiedlich sein.
In der Umgangssprache beschreibt der Begriff „Long-Covid“ alle Beschwerden, die nach der Akutphase einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer Corona- Impfung anhalten. Halten die Beschwerden länger als 12 Wochen an, wird der offizielle Begriff „Post-COVID-Zustand“ oder „Post-COVID-Syndrom (PCS)“ verwendet. Auf dieser Website verwenden wir einheitlich den Begriff „Long-Covid“.
Long-Covid betrifft verschiedene Körpersysteme
Wichtigste Symptome
PEM (Post-Exertionelle Malaise): Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung.
Belastungsintoleranz: Beschwerden treten direkt während der Belastung auf.
Kreislaufprobleme (POTS, orthostatische Intoleranz): Schwindel, Herzrasen oder Schwäche beim Aufstehen.
Fatigue/Erschöpfung: Anhaltende extreme Müdigkeit.
Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme: „Gehirnnebel“, Schwierigkeiten beim Denken.
Schlafstörungen: Nicht erholsamer Schlaf, oft trotz langer Ruhezeiten.
Atemprobleme: Kurzatmigkeit, oft durch eine gestörte Sauerstoffaufnahme.
Kopfschmerzen: Unterschiedlich starke und langanhaltende Schmerzen.
Muskelbeschwerden: Schmerzen und Schwäche in den Muskeln.
Nervenschmerzen: Brennende, stechende oder kribbelnde Schmerzen in Nervenbahnen.
Rolle der Spikeproteine
Spikeproteine spielen eine wichtige Rolle in der Krankheitsentstehung von Long-Covid. Sie besitzen verschiedene schädliche Eigenschaften, die zu krankmachenden Folgereaktionen im Körper führen können.
Schädigung der Gefässwand durch Spike-Protein
Die Spike-Proteine haften sich hartnäckig an die Zellen, die die Innenwand der Blutgefäße auskleiden (Endothelzellen) und verursachen so eine Entzündung an der Gefässwand. Zusätzlich dringen die Spike-Proteine in das Innere der Endothelzellen ein (Transfektion) und verursachen dort ebenfalls eine Entzündung. Dies führt zu einer chronischen Entzündung, die als Endotheliitis bezeichnet wird.
Erhöhte Gefässpermeabilität
Durch die Entzündung werden die Gefäßwände durchlässiger, sodass unerwünschte Stoffe aus dem Blut in das Gewebe gelangen können.
Mikrozirkulationsstörungen
Infolge der Entzündung schwillt das Endothel an, was die Durchblutung behindert (Mikrozirkulationsstörung). Dadurch wird die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des umliegenden Gewebes eingeschränkt.
Verbleibende Virenbestandteile im Körper
Bei einigen Long-COVID-Betroffenen werden stark erhöhte Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen. Teile des Coronavirus SARS-CoV-2 oder Teile des Virus (wie virale RNA oder Proteine) können auch nach einer überstandenen Infektion im Körper verbleiben. Diese können das Immunsystem anhaltend aktivieren und so eine chronische Entzündung auslösen.
Fehlregulation des Immunsystems
Das Spike-Protein kann eine Fehlregulation des Immunsystems auszulösen. Dies führt zu einer unkontrollierten Abwehrreaktion, bei der entzündungsfördernde Stoffe im Körper freigesetzt werden.
GPCR-Autoantikörper
Bei Long-Covid spielen die sogenannten GPCR-Autoantikörper eine wichtige Rolle. Sie richten sich gegen spezifische Rezeptoren, die sich auf der Zelloberfläche befinden. GPCR-Rezeptoren sind Rezeptoren, die biologische Prozesse im Körper steuern. Dazu gehören die Signalübertragung, die Blutdruckregulierung, die Immunabwehr und die Zellbewegung.
Autoimmunerkrankung durch körperähnliche Proteine
Ähnlichkeiten zwischen dem körpereigenen Gewebe und dem Spike-Protein kann das Immunsystem fehlleiten, sodass es fälschlicherweise eigenes Gewebe angreift, anstatt nur das Virus zu bekämpfen. Diese Verwechslung, bekannt als molekulare Mimikry, kann zu anhaltenden Entzündungen und Gewebeschäden führen. Die Autoimmunreaktion findet über sogenannte Autoantikörper statt, welche sich gegen das eigene Körpergewebe richten. Entsprechende Autoantikörper können im Blut nachgewiesen werden.
Was passiert bei einer Mikrozirkulationsstörung?
Es gibt größere Arterien, die sich in kleinere Arteriolen verzweigen. In den Arteriolen wird der Blutdruck reguliert. Die kleinsten Gefässe sind die Kapillaren, in denen der Austausch von Gasen wie Sauerstoff und Kohlendioxid sowie der Austausch von Nährstoffen und Abfallstoffen stattfindet.
Auch die größeren Arterien selbst brauchen eine eigene Blutversorgung, die durch winzige Gefässe, die sogenannten Vasa Vasorum („Gefässe der Gefässe“), sichergestellt wird. Diese kleinen Gefässe schlingen sich um die Muskeln der Arterien und versorgen diese mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn die Mikrozirkulation gestört ist, können die Vasa Vasorum nicht mehr richtig arbeiten, was zu einer Unterversorgung der Arterienmuskulatur[1] führt.
Ähnlich funktionieren die Vasa Nervorum, kleine Blutgefäße, die die Nerven mit Blut versorgen. Bei Mikrozirkulationsstörungen kann es auch hier zu Durchblutungsproblemen kommen, wodurch die Nerven weniger Sauerstoff und Nährstoffe erhalten, was zu einer Beeinträchtigung der Nervenfunktion führen kann.
Nervensystem – Blut-Hirn-Schranke
Die Blut-Hirn-Schranke ist eine Schutzbarriere im Gehirn, die bestimmt, welche Stoffe aus dem Blut ins Gehirn gelangen dürfen. Das Spike-Protein kann die Schutzfunktion der Blut-Hirn-Schranke stören, was entzündliche Prozesse im Nervensystem auslösen kann. Symptome wie Hirnnebel (Brainfog), Kopfschmerzen und neurologische Langzeitfolgen könnte damit erklärt werden.
Nervensystem – Mikroglia
Im zentralen Nervensystem kann das Spike-Protein bestimmte Immunzellen aktivieren (Mikroglia), die Entzündungen auslösen können.
Mikrobiom
Das Gleichgewicht der Darmbakterien (Mikrobiom) kann durch Long-Covid gestört werden. Störungen im Darmmikrobiom können Entzündungen im ganzen Körper fördern und die Regulation des Immunsystems negativ beeinflussen. Eine Darmsanierung ist für die Genesung immer mitentscheidend.
Gestörte Blutdruckregulation
Zellen besitzen Rezeptoren, an denen Stoffe (z.B. Hormone) andocken, um ihre Wirkung zu entfalten. Das Spike-Protein von SARS-CoV-2 bindet an den ACE2-Rezeptor, der auf verschiedenen Zelltypen wie in Blutgefäßen, dem Herzen, der Lunge und dem Darm vorkommt. Der ACE2-Rezeptor ist wichtig, um den Blutdruck und den Flüssigkeitshaushalt im Körper zu regulieren. Wird es durch das Virus blockiert, kann diese wichtige Funktion, wie z.B die Regulierung des Blutdruckes gestört werden.
Mitochondrien – Energiekraftwerke der Zellen
Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und sind für Energieproduktion des Körpers verantwortlich. Sie können durch SARS-CoV-2 geschädigt werden was zur Verminderung der Energieproduktion führt und einen Einfluss auf alle Körperfunktionen hat. Eine Schädigung der Mitochondrien kann zu einer erhöhten Produktion von entzündlichen Molekülen führen.
[1] Die Arterien sind mit eigenen Muskeln in den Gefässwänden ausgestattet mit welchen das Blut im Gefäss weitertransportiert wird.
Therapie
Fachärzte für Ursachen- und Umweltmedizin sind auf die Behandlung von Long-COVID spezialisiert. Das Wissen über Ursachen und Therapiemöglichkeiten wächst kontinuierlich und die Behandlung entsprechend verbessert. Die Behandlung umfasst möglichst alle betroffenen Körpersysteme.
Behandlungsbeispiel (keine komplette Therapie)
Die Behandlungsmöglichkeiten für das Post-Covid-Syndrom variieren je nach Schwere der Symptome. In einigen Fällen kann eine kurzzeitige Gabe von Cortison zur Eindämmung der Entzündung erfolgen. Eine andere Therapieoption ist die Apherese/INUSpherese [1,2], bei dem Autoantikörper aus dem Blut entfernt werden. Alternativ kann auch das Medikament Rituximab eingesetzt werden. Beide Therapien erfordern viel Erfahrung und werden daher in spezialisierten Kliniken oder Praxen durchgeführt.
Bei milderen Verläufen können auch Nahrungsergänzungsmittel wie Curcumin oder Weihrauch eingesetzt werden, da sie entzündungshemmende Eigenschaften haben. Diese wurden bereits erfolgreich bei akuten Covid-19-Infektionen eingesetzt. Im Gegensatz zu Cortison haben Curcumin und Weihrauch keine nennenswerten Nebenwirkungen. Eine begleitende Gabe von Bromelain, einem Enzym, das entzündungshemmend wirkt und antivirale Eigenschaften hat, wird ebenfalls beschrieben. Es kann in Kombination mit anderen Enzymen wie Papain und Rutin verwendet werden [3,4,6,7,8].
[1] https://www.nature.com/articles/s41380-021-01148-4 [2] https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT02229942 [3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35882701/ [4] https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153396 [6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32393899/ [7] https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/at-1-antagonisten-sartane [8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33635001/
Hinweis: Sämtliche medizinische Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie dienen ausdrücklich nicht als Ersatz für professionelle Diagnosen, Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete Fachpersonen.